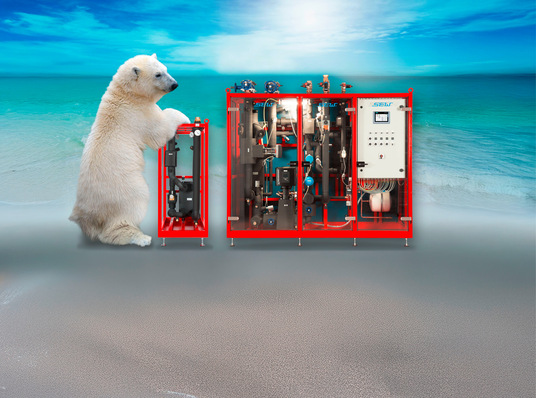Nach Konfuzius heißt es: „Wenn die Worte nicht stimmen, dann ist das Gesagte nicht das Gemeinte. Wenn das, was gesagt wird, nicht stimmt, dann stimmen die Werke nicht.“ In Fachpublikationen, aber auch sowohl in Normen und Richtlinien als auch in Gesetzestexten werden Begriffe verwendet, die fachlich als auch thermodynamisch nicht korrekt sind, so z. B. Wärmetauscher statt Wärmeübertrager: Man kann die Wärme nicht tauschen, sondern nur übertragen!
Weitere Beispiele falscher Terminologie
Ein weiteres Negativbeispiel ist die „Rückwärmezahl“ in der Wärmerückgewinnung: Richtig wäre hier „Übertragungsgrad“. Denn eine Zahl kann den Wert von 0 bis unendlich einnehmen, ein Übertragungsgrad nur den Wert von 0 bis 1 (oder 100 Prozent). Ebenso inkorrekt ist es, von einer „reversiblen“ Wärmepumpe“ zu sprechen: Denn reversibel bedeutet in der Thermodynamik ohne Verluste bei der Umkehrung eines Prozesses. Der oft verwendete – inkorrekte - Begriff kommt wahrscheinlich aus der englischen Übersetzung „reversibel = umkehrbar, doppelseig, wendbar“. Auch die Bezeichnung „Klimaanlage“ ist interpretationswürdig [3].
Es ist nach Auffassung des Autors eine Frage der wissenschaftlichen und publizistischen Seriosität von Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, aber auch Produktwerbungen, sich korrekt auszudrücken bzw. zu formulieren, damit der Leser bzw. Anwender nicht womöglich zu unkorrekten Schlussfolgerungen kommen kann.
So wird „Frischluft“ richtig definiert
Laut Duden ist unter dem Adjektiv „frisch“ zu verstehen: „nicht alt (Lebensmittel); unverbraucht; eben erst (entstanden, hergestellt, ausgeführt). Auch Luft wird im Allgemeinen als „Lebensmittel“ verstanden.
Weiterhin wird nach dem Duden definiert: „Frischluft: frische, unverbrauchte Luft“. Tabelle 1 zeigt eine fremdsprachliche Gegenüberstellung von Außenluft und Frischluft.
Kann man davon ausgehen, dass die Außenluft „frisch und unverbraucht“ sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, in Industriegebieten oder in Tälern oder auf den Bergen die gleiche Eigenschaft hat? Wohl doch eher nicht!

In der DIN EN 16798 Blatt 3 [1] wie auch vorher in der DIN EN 13779 [2] wird die Außenluft entweder mit AUL oder ODA definiert. In der DIN EN 16798 [1] sind die Luftbezeichnungen für raumlufttechnische Anlagen (RLT) im Allgemeinen an Orte oder Richtungen geknüpft, jedoch nicht an Eigenschaften, wie es z.B. in der Trinkwasserverordnung üblich ist. Nur in der Meteorologie werden die Begriffe Kalt- und Warmluft verwendet.
Tabelle 2: Klassifizierung der Außenluft nach [1]:

In der nicht mehr gültigen DIN EN 13779 [2] wird für eine derartige Klassifizierung folgende Herangehensweise vorgeschlagen:
Diese Untersetzung ist in der DIN EN 18789 Bl. 3 [1] entfallen. Weiterhin sind Komponenten (gasförmige Bestandteile und Partikel) der Außenluft definiert:
Tabelle 3 Klassifizierung der Außenluft (ODA) anhand von Partikeln:.

Fazit
Zumindest in der Fachpresse sollte man sich bemühen, eindeutige fachliche Begriffe zu verwenden und Autoren von Fachbeiträgen seitens der Redaktionen auf korrekte Begriffsbildung hinweisen.
(Kommentar der Redaktion: Wir geloben Besserung, bitten aber auch um Nachsicht, sollte uns und unsere Autoren ein terminologischer Fehler unterlaufen.) ■
Literatur
[1] DIN EN 16798 Blatt 3 (Entwurf): Energieeffizienz von Gebäuden - Blatt 3: Anforderungen an die Leistung von Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsystemen (Module M 5-1, M5-4) (deutsche und englische Fassung), 12/2022, Beuth Verlag GmbH, Berlin.
[2] DIN EN 13779 Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme; deutsche Fassung, 09/2007, Beuth Verlag GmbH, Berlin.
[3] Trogisch, A.: Definition des Begriffs „Klimaanlage“, 2013, H. 11, S. 28 -33; KI-Kälte-, Luft- und Klimatechnik, Hüthig-Verlag, Heidelberg.